Datenschutzrecht
Deine Daten sind wertvoll – deshalb solltest Du wissen, wer sie verarbeitet und was erlaubt ist. Hier bekommst Du rechtliche Klarheit über Deine Datenschutzrechte, über Auskunfts- und Löschansprüche sowie über typische Stolperfallen im Netz. Mit unseren Tipps behältst Du die Kontrolle über Deine persönlichen Informationen.
Aktuelles

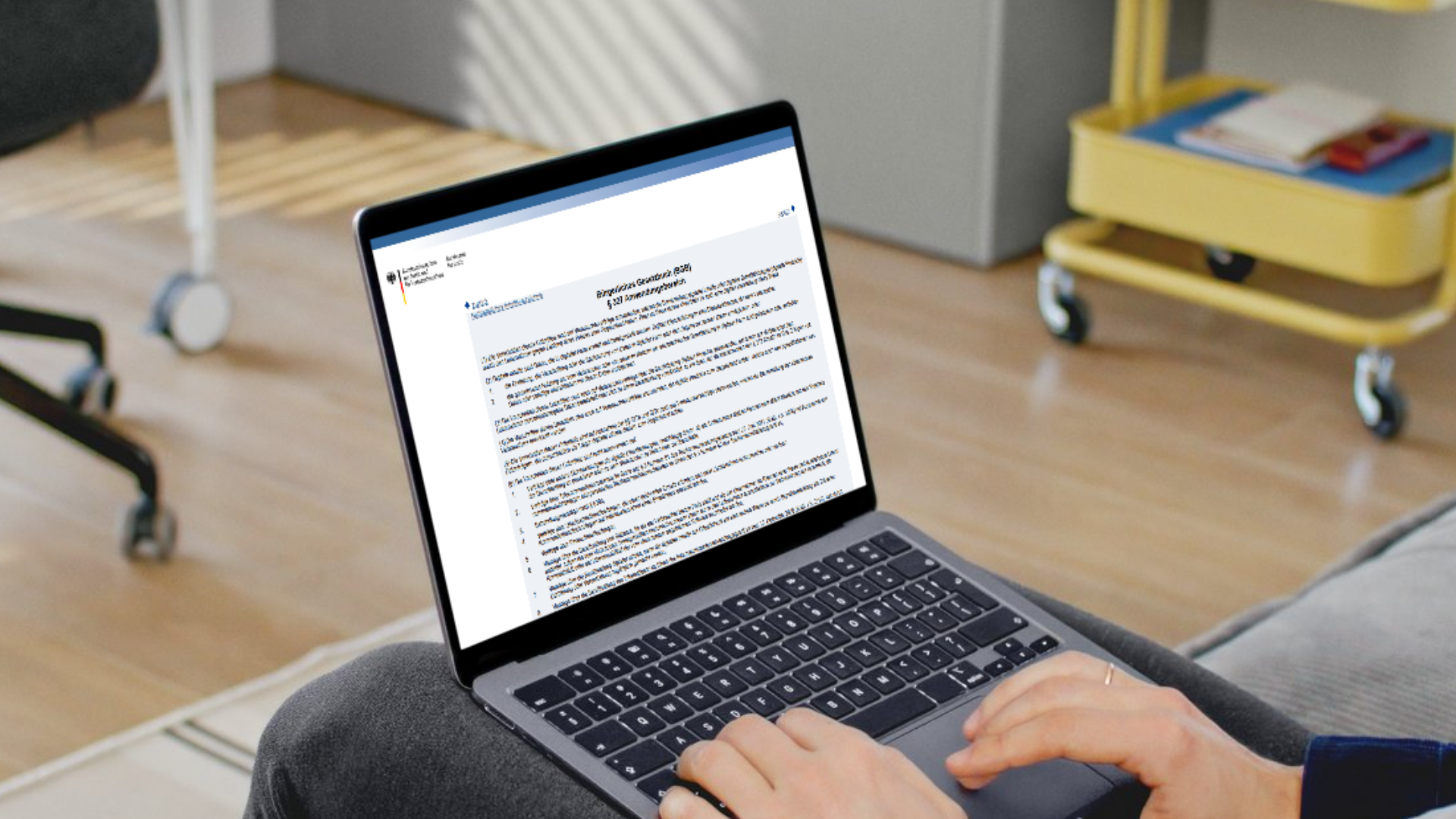


Warum uns Datenschutzrecht so wichtig ist
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein zentrales Grundrecht in der digitalen Gesellschaft. Verbraucher hinterlassen täglich Daten – online, beim Bezahlen, im Kontakt mit Unternehmen oder Behörden. Das Datenschutzrecht sorgt dafür, dass diese Daten rechtlich geschützt sind und nicht zweckwidrig verwendet werden. Wir fördern die Durchsetzung datenschutzrechtlicher Ansprüche und schaffen rechtliche Orientierung in einer datengetriebenen Welt.
Kurz erklärt: Das Themenfeld Datenschutzrecht
- Das Datenschutzrecht regelt die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten.
- Es basiert auf der Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz.
- Es betrifft Auskunftsrechte, Löschansprüche, Einwilligungen und Datenübertragbarkeit.
- Verantwortliche Stellen unterliegen klaren Informationspflichten und Haftungsregelungen.
Unsere FAQ zu Datenschutzrecht
Welche Daten dürfen Unternehmen über mich speichern und was nicht?
Unternehmen dürfen grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten speichern, die zur Erfüllung eines konkreten Zwecks notwendig sind. Das umfasst etwa Name, Adresse, Kontaktdaten oder Zahlungsinformationen, wenn Du eine Dienstleistung nutzt oder einen Vertrag abschließt. Darüber hinausgehende Daten, wie Dein Surfverhalten, Vorlieben oder Standortdaten, dürfen nur mit Deiner ausdrücklichen Einwilligung erhoben werden. Unverhältnismäßige oder heimliche Datensammlungen sind unzulässig. Jede Datenerhebung muss nachvollziehbar, zweckgebunden und rechtlich begründet sein.
Wie kann ich herausfinden, welche Daten ein Unternehmen über mich gespeichert hat?
Du hast nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung das Recht, Auskunft über alle gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht gilt kostenlos und ohne Begründung. Das Unternehmen muss Dir innerhalb eines Monats mitteilen, welche Daten es gespeichert hat, woher sie stammen, wofür sie genutzt werden und an wen sie weitergegeben wurden. Du kannst den Antrag formlos per E-Mail oder Post stellen. Bei Verstößen kannst Du Dich an die zuständige Datenschutzbehörde wenden.
Kann ich verlangen, dass meine Daten gelöscht werden?
Ja, das sogenannte „Recht auf Vergessenwerden“ gibt Dir unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung Deiner Daten. Das gilt zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Zweck der Speicherung entfällt, Du Deine Einwilligung widerrufst oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Unternehmen sind dann verpflichtet, die Daten vollständig zu löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Löschung kannst Du schriftlich beantragen. Bei Weigerung hast Du das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht einzureichen.
Was kann ich tun, wenn meine Daten missbräuchlich verwendet wurden?
Wird Deine Privatsphäre verletzt, weil Daten ohne Deine Zustimmung weitergegeben, verkauft oder unzulässig verarbeitet wurden, hast Du das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Deines Bundeslandes. Zusätzlich kannst Du unter Umständen Schadensersatz geltend machen. Wichtig ist, Beweise zu sichern, etwa durch Screenshots, E-Mails oder Log-Dateien. Auch eine Unterlassungserklärung oder Abmahnung kann sinnvoll sein, wenn Du künftig nicht mehr betroffen sein willst. Datenschutzverstöße sind kein Kavaliersdelikt und können ernsthafte rechtliche Konsequenzen haben.

